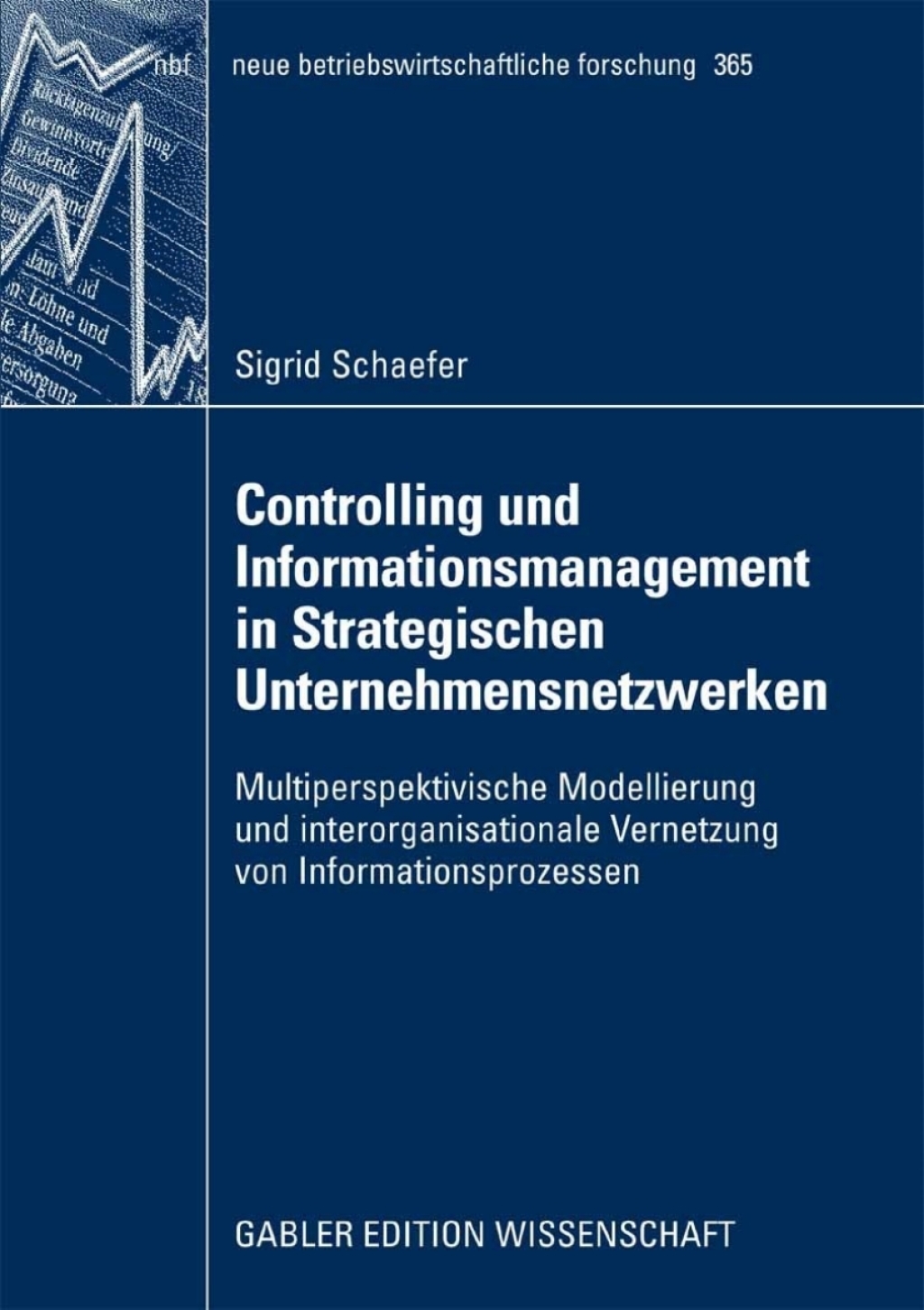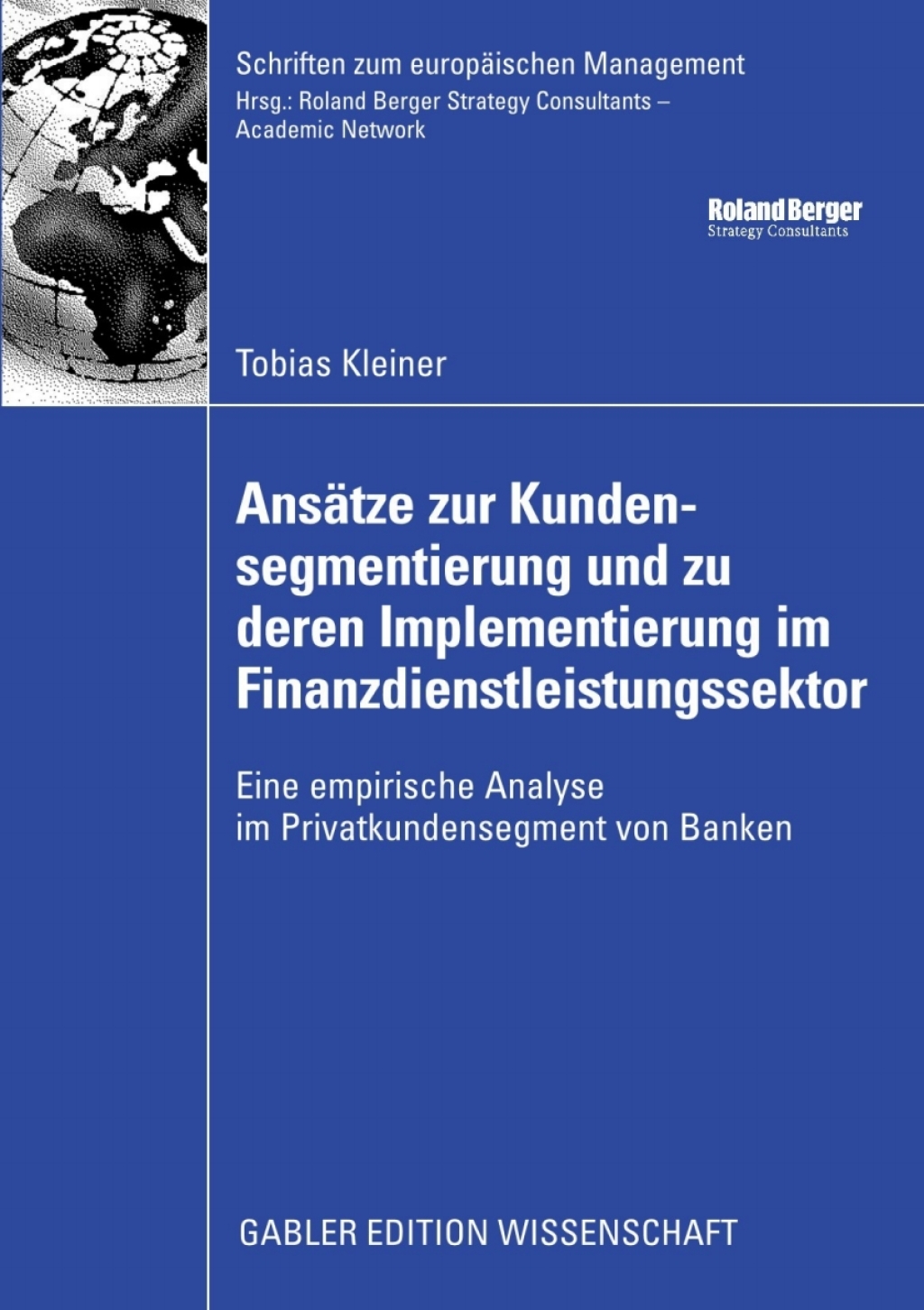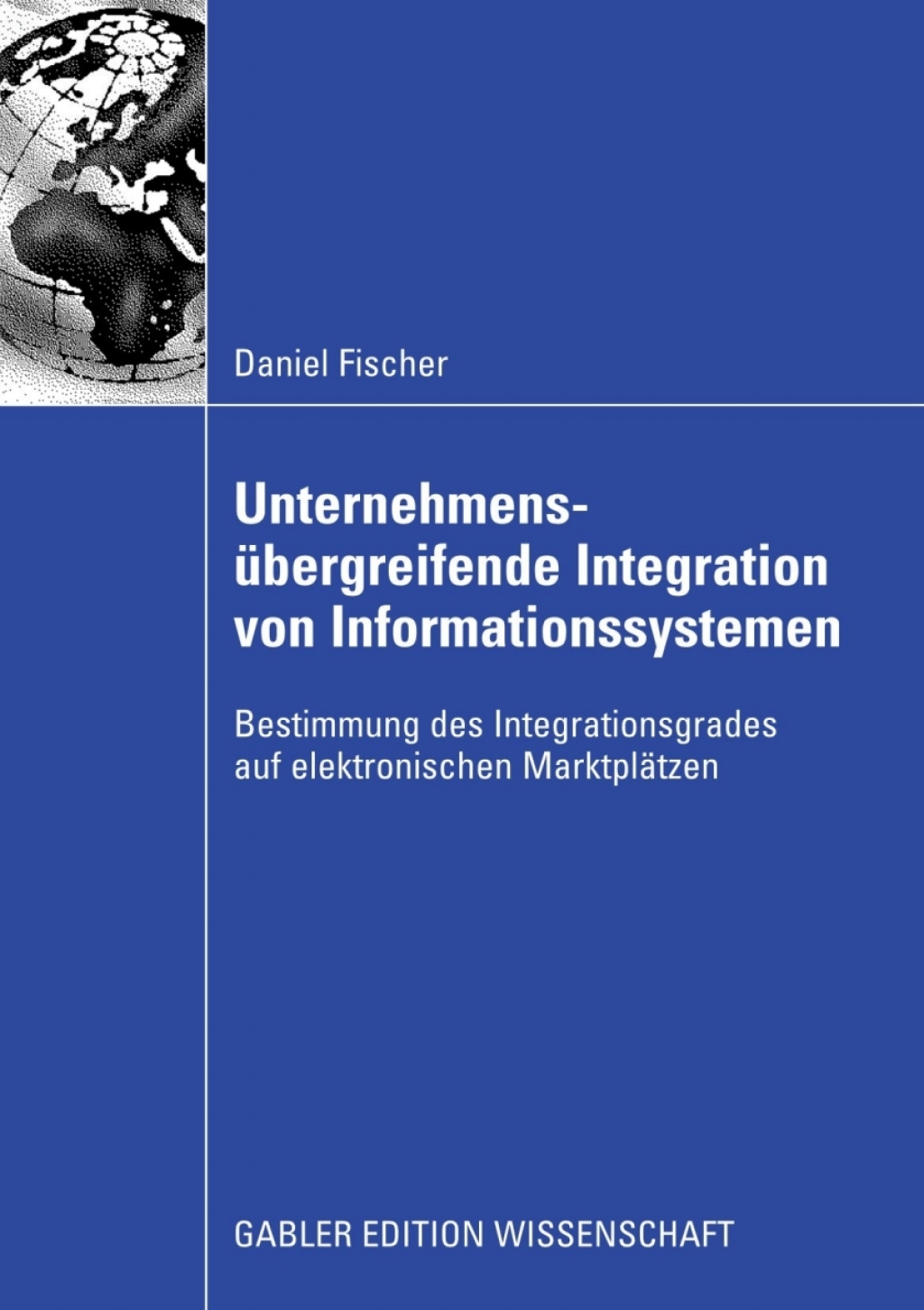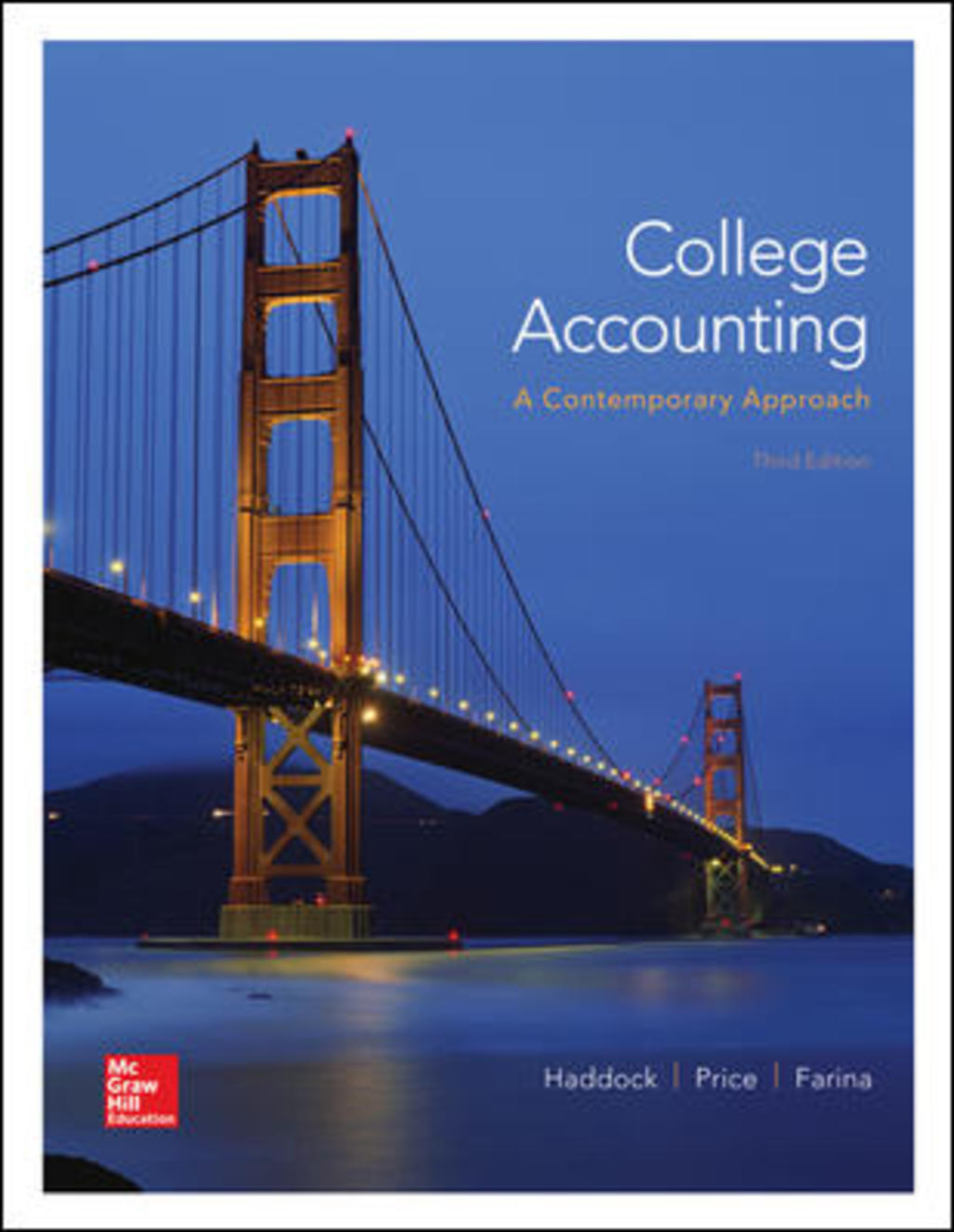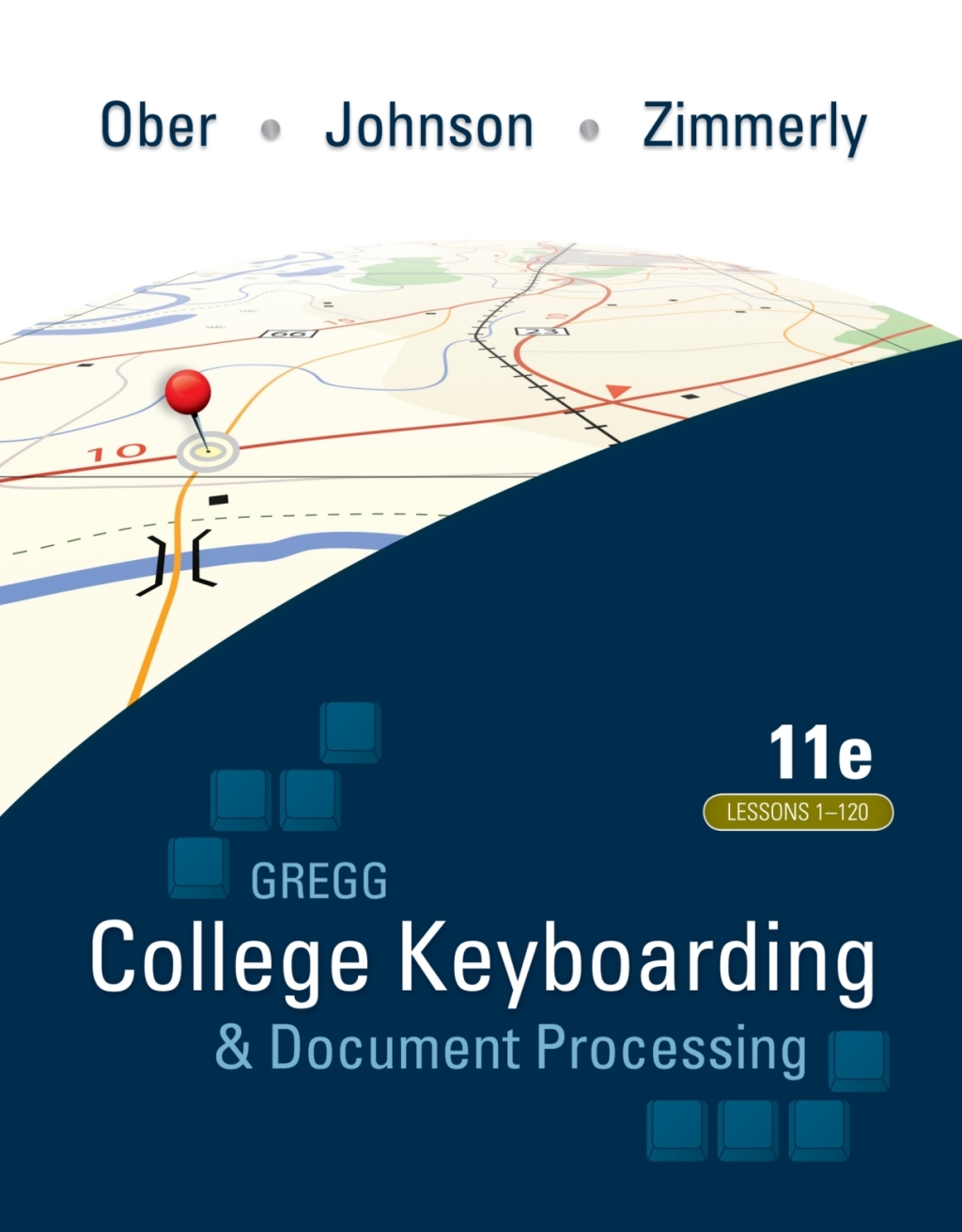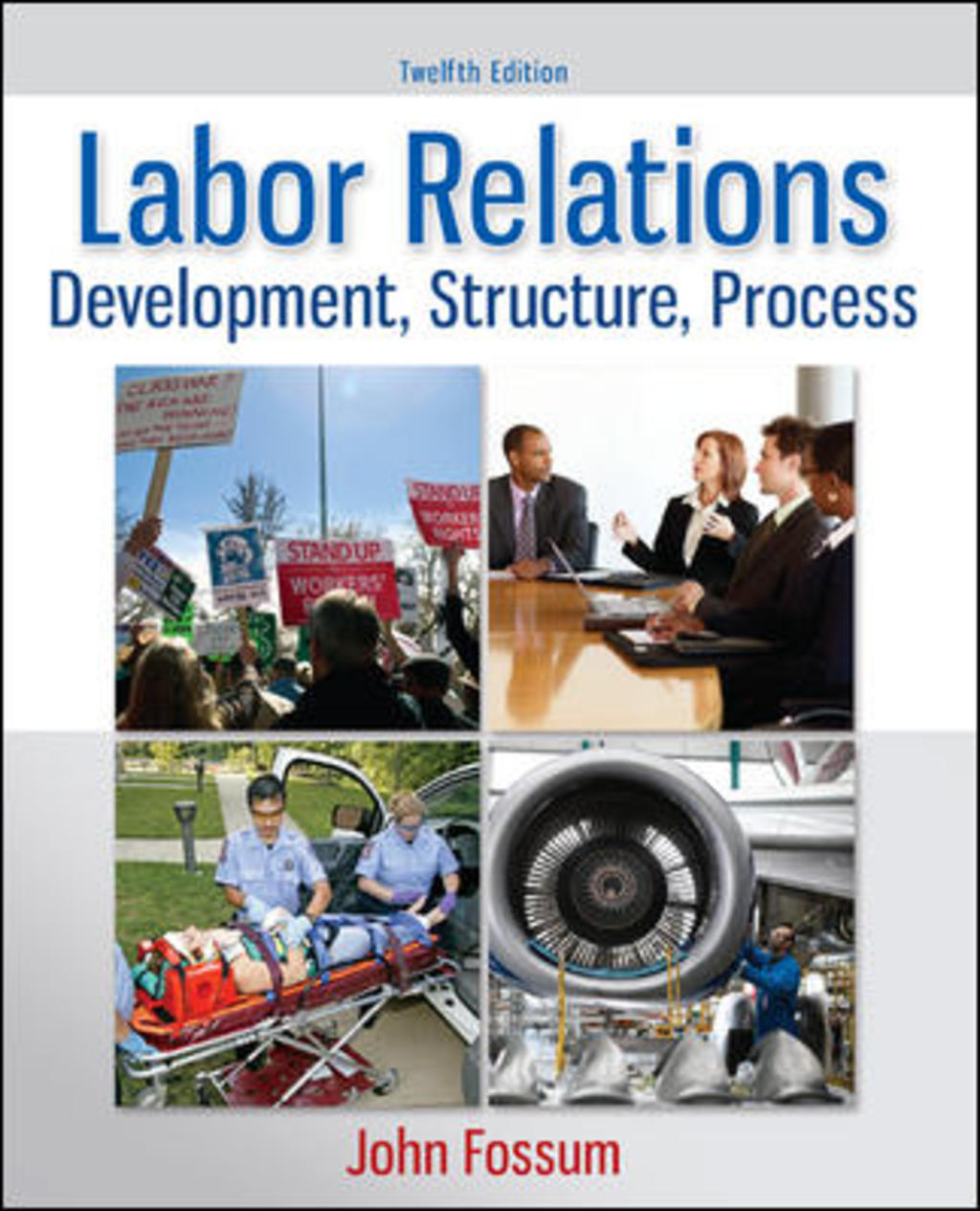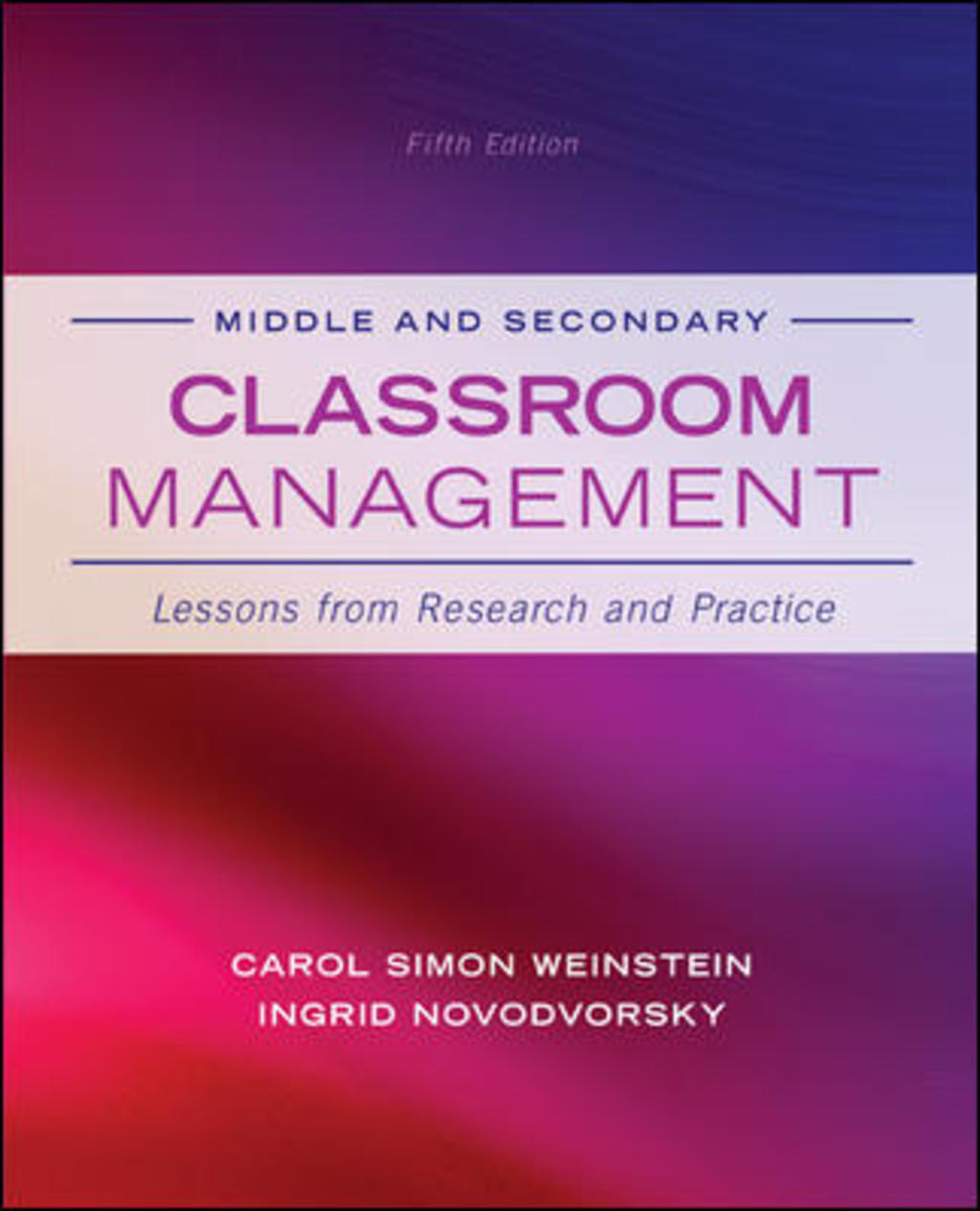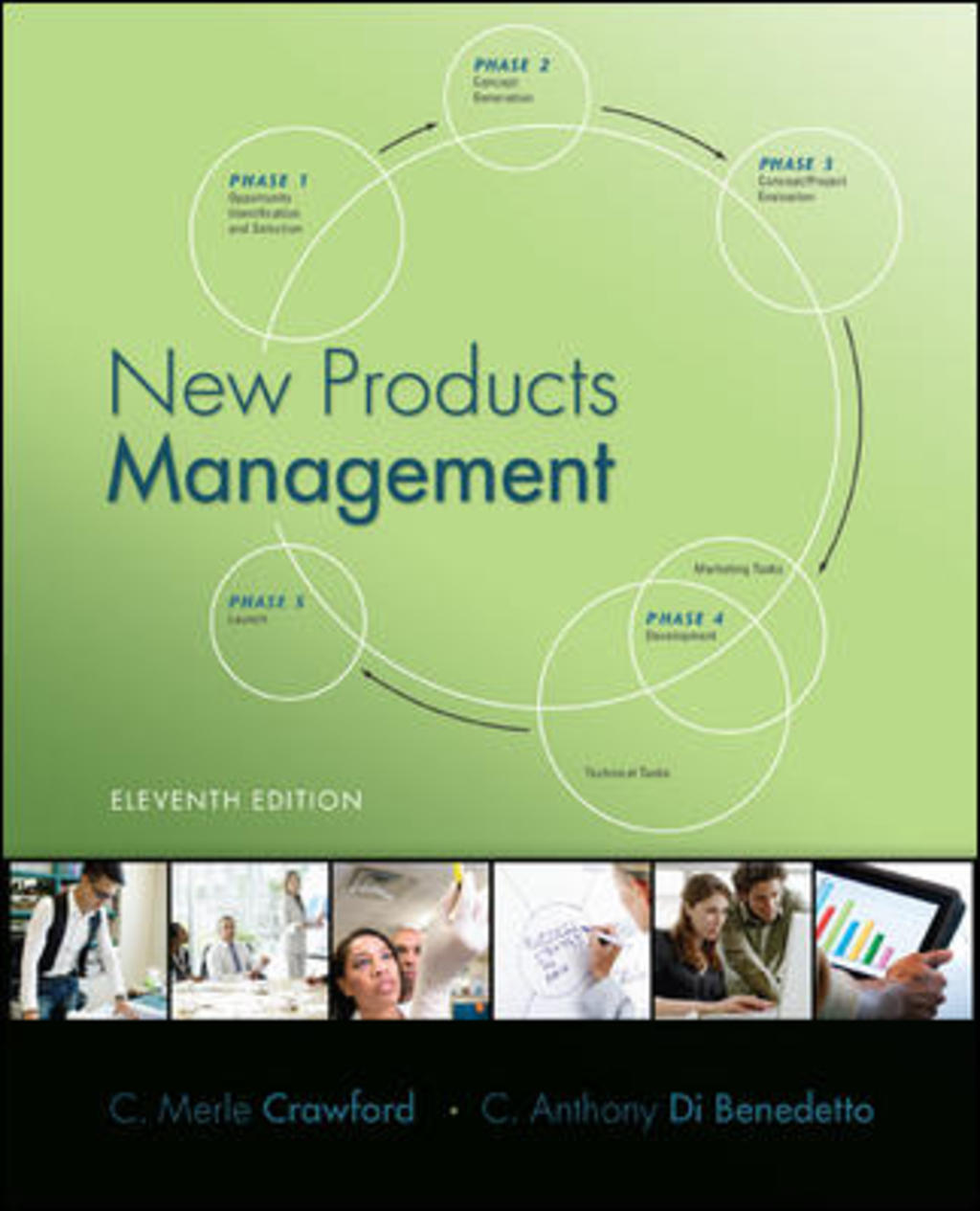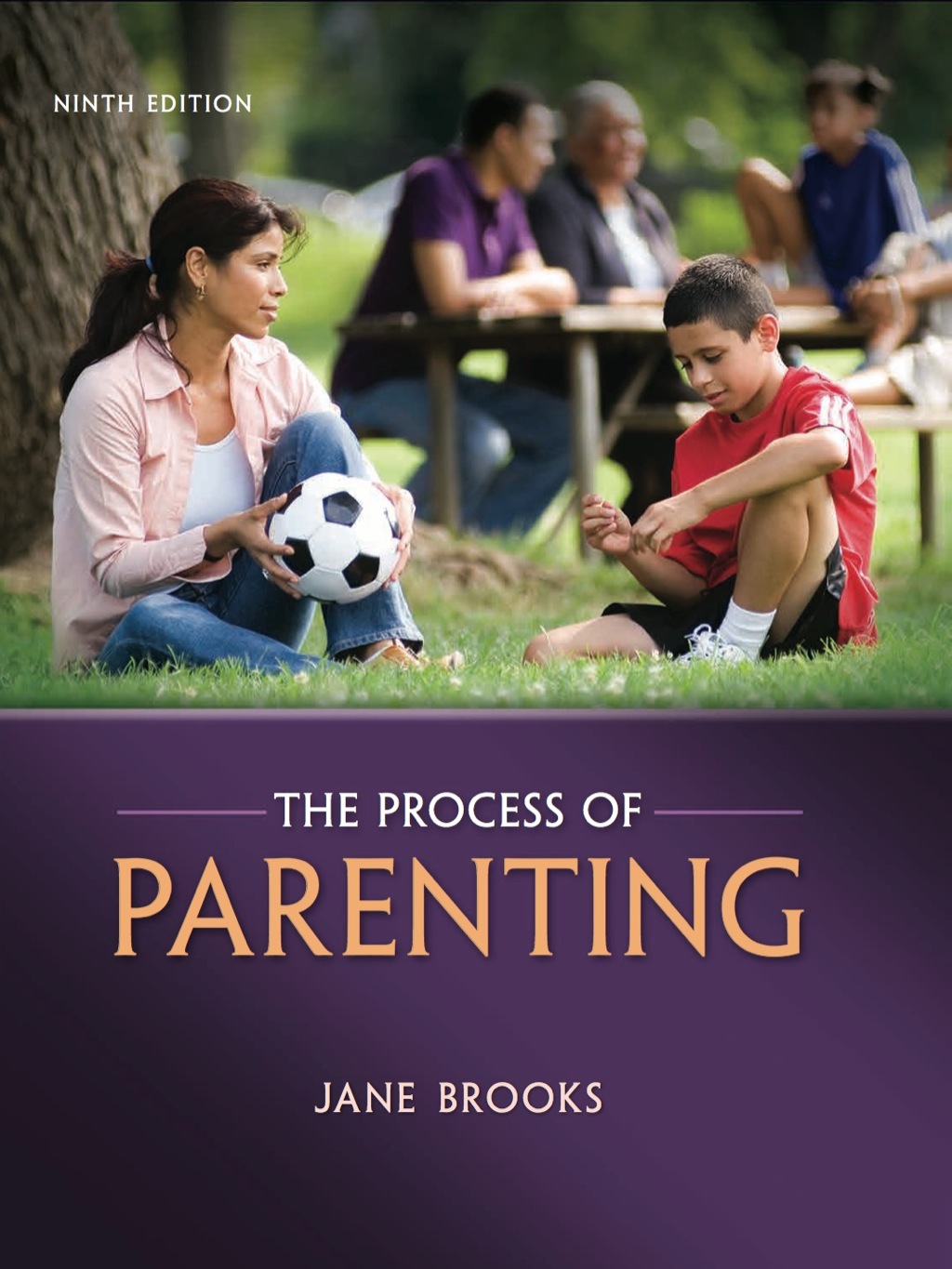Description
Integration von Informationssystemen ist bereits seit mehr als 40 Jahren eine wichtige A- gabe der Praxis und ein zentraler Forschungsgegenstand der Wirtschaftsinformatik. Vielfach wird empfohlen, bei der Integration von Informationssystemen einen „optimalen Integrationsgrad“ anzustreben. Erstaunlicherweise gibt es aber nur wenige Untersuchungen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie der Integrationsgrad von Informationssystemen – stimmt werden kann. Publikationen zu diesem Thema deuten Möglichkeiten zur Beschr- bung und Bewertung des Integrationsgrads von Informationssystemen häufig nur an. Die Integrationsforschung in der Wirtschaftsinformatik hat sich bisher einseitig auf die Analyse der erwünschten Effekte der Integration, wie Ressourcenschonung, Redunda- reduktion und Konsistenzerhöhung, konzentriert. Unerwünschte Effekte, wie z. B. die Intensivierung von Abhängigkeiten und die Erhöhung von Wechselkosten, sind dagegen bisher nicht angemessen untersucht worden. Im Rahmen der so genannten Netz-Ökonomie werden Abhängigkeiten von Produkten und Unternehmen unter den Stichworten Lock-In bzw. Wechselkosten thematisiert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse haben bisher nicht in nennenswertem Umfang Eingang in die Integrationsforschung gefunden. Die immer engeren Verflechtungen von Unternehmen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Logistik, im Finanzdienstleistungssektor oder im Handel, führen zu einer immer stär- ren unternehmensübergreifenden Integration von Informationssystemen. Damit ist die Gefahr unerwünschter Abhängigkeiten zwischen Unternehmen und damit Flexibilitä- verlust verbunden. Gerade die Flexibilität ist aber für viele Unternehmen ein vordringliches Ziel. Seit vielen Jahren handeln und kooperieren Unternehmen mit Hilfe vonelektronischen Marktplätzen. Die Integration von Informationssystemen auf Marktplätzen ist vielschichtig und kann sehr unterschiedlich gestaltet werden. Dementsprechend komplex sind Beschr- bung und Bewertung von Gestaltungsoptionen der Integration auf Marktplätzen.